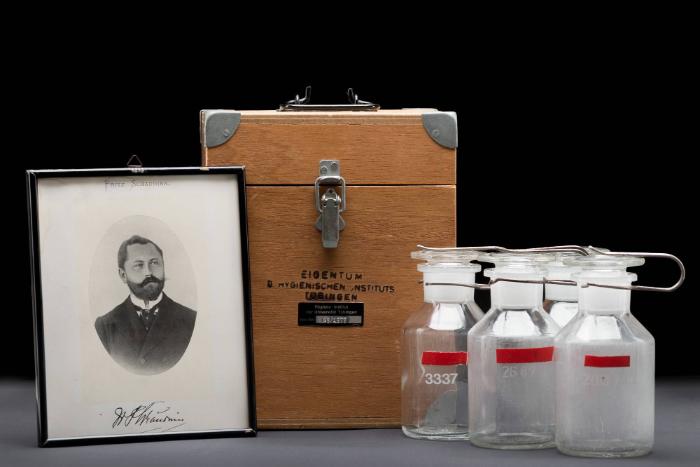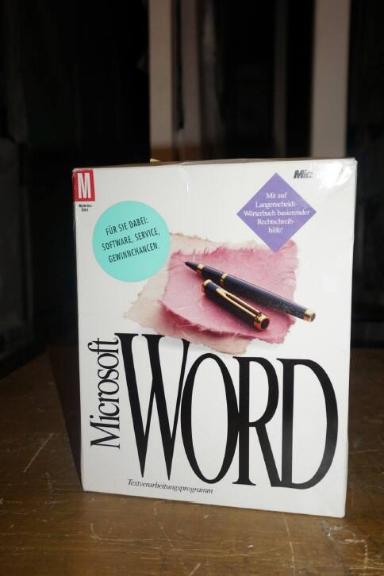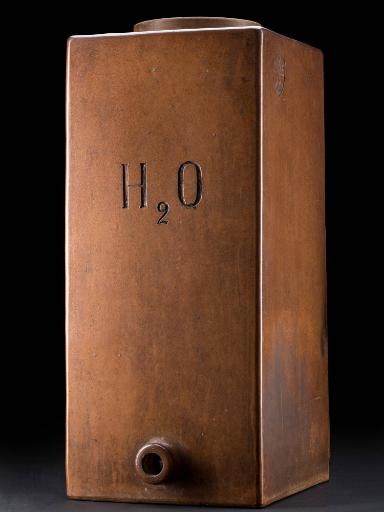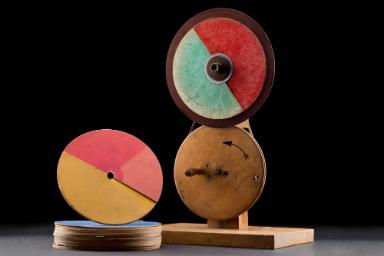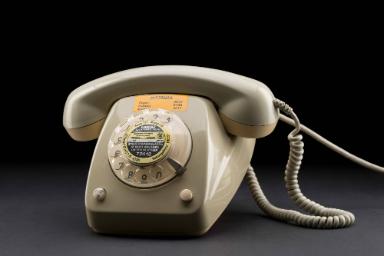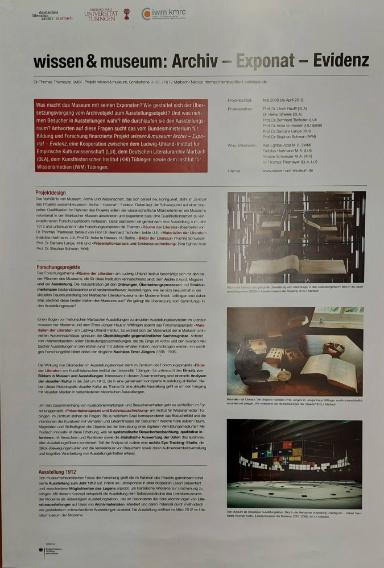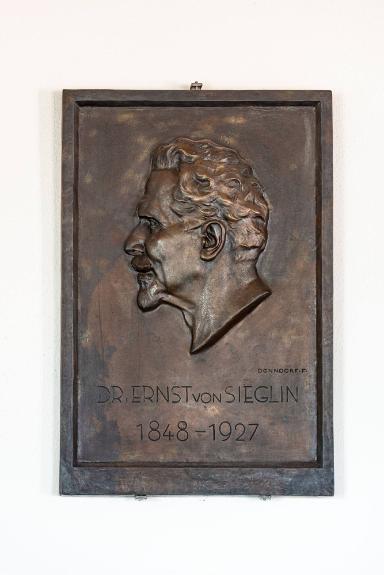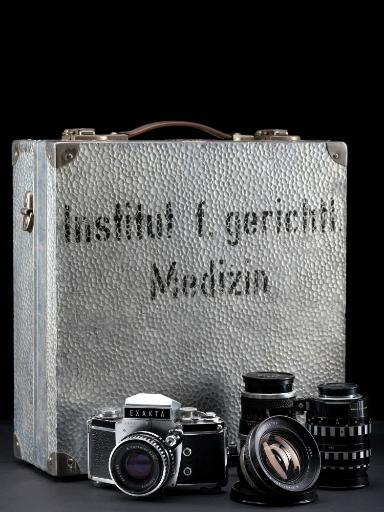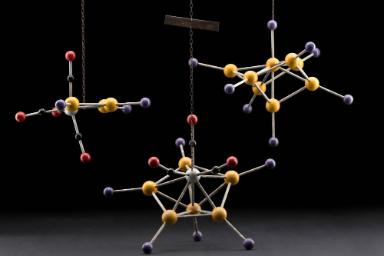Advanced Search
"Im Dienst der Gesundheit
Im Jahr 1906 wurde das Hygiene-Institut Tübingen, als Teil der Medizinischen Fakultät in der Münzgasse mit einer Größe von nur zwei Räumen gegründet. Heute ist es Teil des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und ist ein vom Land akkreditiertes Labor, das berechtigt ist, Wasserproben zur amtlichen Kontrolle der Wasserqualität zu entnehmen und zu analysieren. Behälter wie die vorliegenden dienten zum Transport
der Proben von der Entnahmestelle ins Labor. Zum Schutz der gläsernen Probenbehälter ist der Transportkasten vierfach unterteilt und zusätzlich mit Schaumstoff ausgekleidet. Die Proben selbst wurden in 250 ml Weithals-Standflaschen abgefüllt. Sie waren mit Schliffstopfen aus Glas verschlossen und zusätzlich mit einem Bügel versehen, um ein versehentliches Öffnen während des Transports zu verhindern. Auf den Flaschen
finden sich noch die alten, fest angebrachten Probennummern. Mit deren Hilfe konnten die Proben „anonym“ analysiert und anschließend wieder den Entnahmestellen und damit den Auftraggebern zugeordnet werden."
-Jakob Luther
Zit. in: Christine Nawa, Ernst Seidl (Hg.): Wohin damit? Strandgut der Wissenschaft, Tübingen 2015.
Wasserproben- Transportbehälter
DepartmentFundus Wissenschaftsgeschichte am MUT
Date1977
DescriptionHolzbox mit 4 Glasbehältern;
3 mit Metallverschlussklemme"Im Dienst der Gesundheit
Im Jahr 1906 wurde das Hygiene-Institut Tübingen, als Teil der Medizinischen Fakultät in der Münzgasse mit einer Größe von nur zwei Räumen gegründet. Heute ist es Teil des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und ist ein vom Land akkreditiertes Labor, das berechtigt ist, Wasserproben zur amtlichen Kontrolle der Wasserqualität zu entnehmen und zu analysieren. Behälter wie die vorliegenden dienten zum Transport
der Proben von der Entnahmestelle ins Labor. Zum Schutz der gläsernen Probenbehälter ist der Transportkasten vierfach unterteilt und zusätzlich mit Schaumstoff ausgekleidet. Die Proben selbst wurden in 250 ml Weithals-Standflaschen abgefüllt. Sie waren mit Schliffstopfen aus Glas verschlossen und zusätzlich mit einem Bügel versehen, um ein versehentliches Öffnen während des Transports zu verhindern. Auf den Flaschen
finden sich noch die alten, fest angebrachten Probennummern. Mit deren Hilfe konnten die Proben „anonym“ analysiert und anschließend wieder den Entnahmestellen und damit den Auftraggebern zugeordnet werden."
-Jakob Luther
Zit. in: Christine Nawa, Ernst Seidl (Hg.): Wohin damit? Strandgut der Wissenschaft, Tübingen 2015.
Dimensionsmin.:
H x B x T: 24,5 × 19,5 × 19 cm
max.:
H x B x T: 18,8 × 19,5 × 39,5 cm
H x B x T: 24,5 × 19,5 × 19 cm
max.:
H x B x T: 18,8 × 19,5 × 39,5 cm
MediumHolz, Glas, Schaumstoff,
Metall
Object numberMUT-WG-77
vor 1945
1998–1999
1970
1998–1999
um 1960